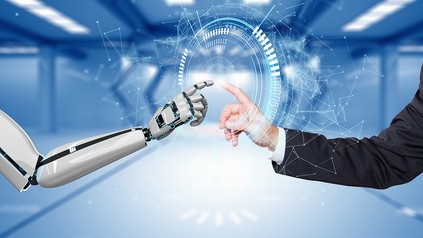KI: Wie Betriebe Schritt halten und Fachkräfte richtig fördern

Künstliche Intelligenz ist in den Betrieben angekommen. Ob Texterstellung, Datenanalyse oder Prozessautomatisierung – KI verändert Arbeitsabläufe tiefgreifend. Trotzdem existiert in Deutschland bislang kein anerkannter Ausbildungsberuf, der sich ausschließlich auf dieses Zukunftsfeld konzentriert.
„Das duale Ausbildungssystem ist gründlich und stabil, aber langsam“, erklärt Autor und Softwareentwickler Markus Schall. „Neue Berufsbilder entstehen erst, wenn Technologien sich über Jahre bewährt haben. Doch bei KI zählt jeder Monat. Unternehmen müssen jetzt selbst aktiv werden.“
Lokale KI als Chance für den Mittelstand
Nicht jede KI muss aus der Cloud kommen. Cloud-Systeme wie ChatGPT oder Gemini sind leistungsfähig, aber teuer und datenschutzkritisch.
Lokale KI-Systeme auf eigener Hardware werden zunehmend zur Alternative – insbesondere in Europa, wo Datenschutz und Unabhängigkeit traditionell hohe Priorität haben.
„Für viele mittelständische Unternehmen ist es sinnvoll, eigene KI-Server im Haus zu betreiben und Mitarbeiter darin auszubilden“, so Schall. „Das schafft Datensouveränität und spart auf Dauer Kosten. Dafür braucht man keine Großkonzerne, sondern Menschen, die Prozesse verstehen und mitdenken können.“
Gerade diese Mischung – technisches Grundverständnis und praxisorientiertes Prozessdenken – ist es, die den Unterschied macht. KI-Kompetenz bedeutet heute nicht zwingend Programmierung, sondern die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, Systeme zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen.
Der „inoffizielle“ Weg zum KI-Spezialisten
Da es keinen formellen Beruf gibt, haben sich zahlreiche Zusatzqualifikationen etabliert. Viele IHKs bieten inzwischen Zertifikate wie „KI-Scout (IHK)“, „KI-Manager (IHK)“ oder „Geprüfter Berufsspezialist für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen“ an. Diese Formate richten sich an Auszubildende, Fachkräfte und Führungspersonal, die KI im eigenen Betrieb praktisch umsetzen wollen.
Parallel dazu wächst die Zahl praxisorientierter Online-Kurse – etwa von Google, IBM, OpenAI oder Coursera. Schall betont jedoch, dass echte Kompetenz nicht durch Zertifikate entsteht, sondern durch Tun: „Ein Azubi, der ein internes KI-Projekt aufsetzt, lernt mehr als jemand, der nur eine Theorieprüfung ablegt. Es geht darum, Strukturen zu erkennen, nicht Tools zu sammeln.“
Empfehlung an Unternehmer: Kleine Schritte, große Wirkung
Statt auf teure Berater zu warten, empfiehlt Schall einfache, interne Projekte, wie etwa die automatische Texterstellung für Produktbeschreibungen, die Analyse von Lagerdaten oder den Aufbau eines kleinen Chatbots auf Basis firmeneigener Dokumente. So entstehe echtes Erfahrungswissen, das später multipliziert werden könne – durch neue Azubis, interne Schulungen und Wissenstransfer. Wichtig sei vor allem, den Lernprozess nicht zu bremsen.
Lernzeit ist keine verlorene Arbeitszeit, sondern eine Investition. Wer seine Leute verstehen lässt, was KI wirklich tut, spart in Zukunft täglich Zeit, Nerven und Geld.
An Berufseinsteiger gerichtet: Selbst lernen, statt warten
Schall empfiehlt einen praktischen Ansatz: Einfache Python-Kenntnisse, freies Experimentieren mit kleinen Datensätzen und das bewusste Dokumentieren des eigenen Lernwegs – zum Beispiel auf GitHub oder LinkedIn.
„Selbstlernen ist die neue Kernkompetenz. Wer zeigt, dass er sich selbstständig einarbeiten kann, hat bessere Chancen als jemand, der nur ein Abschlusszeugnis vorlegt“, so der Autor.
Ausblick: KI wird kein Beruf, sondern ein Bestandteil jedes Berufs
Langfristig, so die Prognose, wird Künstliche Intelligenz keine eigenständige Berufsrichtung mehr sein, sondern eine Querschnittskompetenz – vergleichbar mit Computerkenntnissen in den 1990er Jahren. Jeder Beruf, vom Handwerk bis zur Verwaltung, wird künftig ein Grundverständnis von Daten, Prozessen und KI-Logik benötigen.
Die Unternehmen, die jetzt anfangen, ihre Leute dafür fit zu machen, werden in fünf Jahren die Nase vorn haben.
(openPR/SAHO)